Die leise Stimme der Vernunft
Über Sigmund Freud, sein Werk und seine Schule wird in Wien wieder öffentlich geredet. Dies 40 Jahre nach der Re-Etablierung der von den Nazis verbotenen Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. Das Sigmund-Freud-Museum in Freuds früherer Wohnung in der Berggasse 19 registriert immer höhere Besucherzahlen. Im Oktober kann die rührige Sigmund-Freud-Gesellschaft dank tatkräftiger Unterstützung durch den Wiener Bürgermeister in der Volkshalle des Rathauses eine Ausstellung Zur Geschichte der Psychoanalyse in Wien und in Deutschland präsentieren.
Aber auch in der Bewegung des „großen Abtrünnigen“ tut sich etwas. Vor 25 Jahren (am 6. Juni) starb C. G. Jung. Und nun fanden sich Anfang September seine Anhänger zu ihrem 10. Internationalen Kongreß in West-Berlin zusammen. Thema: Der Schattenarchetypus in einer gespaltenen Welt. Ursprünglich (1912) war der Begriff „Schatten“ von Jung in Anlehnung an Freud als Metapher („Schattenseite der Seele“) für nicht anerkannte Wünsche und verdrängte Persönlichkeitsanteile verwendet worden. Später wollte C. G. Jung erkannt haben, daß dieser „inferiore Komplex“ auch prospektive und konstruktive Keime für die zukünftige Entwicklung enthält — was zu einer skandalösen Fehleinschätzung des Nazismus geführt hat. Nun hoffen die „Jungianer“, daß ihr „gemeinsames Gespräch ein vorsichtiger Beginn“ war, „integrierende seelische Kräfte zu mobilisieren“, die zu einem „Unus Mundus“ führen könnten.
Über die Quellen eines solchen Vorhabens in den Werken Freuds und Jungs meditiert der folgende Text.
Seit dem 5. Mai vorigen Jahres — dem 129. Geburtstag Sigmund Freuds — steht in einer Grünfläche vor der Wiener Votivkirche ein Steinquader zur Erinnerung an den Schöpfer der Psychoanalyse. Die Schriftseite dieses Denkmals im „Sigmund-Freud-Park“ — so heißt seitdem die Anlage — ist dem Hauptgebäude der Universität zugewandt, deren Einstellung zur Lehre Freuds nie konfliktfrei war. Auf dem Monument kann man den von Seneca stammenden Satz lesen: „Die Stimme der Vernunft ist leise.“ Als nicht ausgewiesenes Zitat findet er sich mit dem Wortlaut „Die Stimme des Intellekts ist leise“ in Freuds 1927 erschienener Schrift Die Zukunft einer Illusion. Soll der Text auf dem Stein einen Vorwurf gegen die offiziellen wissenschaftlichen Institutionen dieses Landes formulieren?
K.R. Eissler, der Gralshüter der Sigmund-Freud-Archive in den USA, interpretiert den Passus im Gegenteil als eine Fehlleistung, die symptomatisch sei für die Ignoranz, Ambivalenz und Aggression der Wiener (speziell der Gemeinde Wien und der Sigmund-Freud-Gesellschaft, die für die Errichtung verantwortlich sind) in bezug auf das Genie Sigmund Freuds. Denn der „Uneingeweihte“ müsse „annehmen, daß die Stimme der Vernunft oder, wenn richtig zitiert worden wäre, die Stimme des Intellekts in Freud leise war“. „Oder er mag meinen, die Urheber des Denkmals wollten auf die allgemein untergeordnete Rolle der Vernunft in der Geschichte der Menschheit verweisen.“
Eissler unterstellt außerdem, bei der Denkmalsenthüllung habe es geheißen, daß das Zitat in Das Unbehagen in der Kultur steht. Dort sucht es der Leser jedoch vergebens.
Tatsächlich hat Freud in Die Zukunft einer Illusion folgendes geschrieben: „Wir mögen noch so oft betonen, der menschliche Intellekt sei kraftlos im Vergleich zum menschlichen Triebleben, und recht damit haben. Aber es ist doch etwas Besonderes um diese Schwäche; die Stimme des Intellekts ist leise, aber sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör geschafft hat. Am Ende, nach unzählig oft wiederholten Abweisungen, findet sie es doch. Dies ist einer der wenigen Punkte, in denen man für die Zukunft der Menschen optimistisch sein darf ...“ Eine bemerkenswerte Aussage für einen in der naturphilosophischen Tradition Schelling-Schopenhauer-Nietzsche spekulierenden Denker!
Eissler meint nun, diese Einstellung nehme „eine Sonderstellung im Werk Freuds ein, da sie ein, wenn auch kleines, so doch freundliches Fenster für die Zukunft offen läßt — ein matter Lichtstrahl an einem düster verhangenen Himmel“. Die Schrift Die Zukunft einer Illusion sei „nur eine Zwischenstation zu einem tieferen Erfassen der Menschheitsproblematk“, im (1929 verfaßten) Das Unbehagen in der Kultur finde sich „keine Stelle, die Anlaß für Hoffnung auf einen Primat des Intellekts gäbe. Man kann sagen, daß die ganze Weltansicht Freuds anders getönt wäre, wenn sich jener versöhnliche Satz ım ‚Unbehagen‘ finden ließe“. In den zwei Jahren, die „die wahre Quelle des Zitats von der vorgegebenen trennt, liegt eine folgenschwere Entdeckung Freuds: die Rolle der Aggressions- und Destruktionstriebe“.
Und Eissler glaubt, die Motive für die „Fehlleistung“ gefunden zu haben: „Es waren vielleicht stille Hoffnungen und Widerstände gegen eine schmerzliche Einsicht am Werke, die einem falschen Zitat eine falsche Quellenangabe folgen ließen“.
Soweit der Kern der „Beweisführung“ (Eisslers Text ist unter dem Titel „Sic gloria ingenii. Die Inschrift am Freud-Denkmal in Wien“ in der Nr. 8/86 der Zeitschrift Falter abgedruckt). Diese hält freilich einer Überprüfung nicht stand. Wieso sich Eissler, ein exzellenter Kenner der Werke Sigmund Freuds, derart irren konnte, bedürfte einer eigenen Untersuchung.
Freud hat niemals seinen Glauben an die Emanzipation des Intellekts (der Begriff „Vernunft“ wird von ihm synonym gebraucht) vom Trieb verloren. Mit seiner Schrift Die Zukunft einer Illusion war das Interesse des einundsiebzigjährigen Sıgmund Freud „nach dem lebenslangen Umweg über die Naturwissenschaften, Medizin und Psychotherapie“ (so Freud 1935 in der „Nachschrift“ zu seiner Selbstdarstellung) „zu jenen kulturellen Problemen zurückgekehrt, die dereinst den kaum zum Denken erwachten Jüngling gefesselt hatten“. Das Werk (eine Demontage der Religion, deren sozialer und kultureller Wert bestritten wird) erschien ausgerechnet in jenem Jahr 1927, das den Beginn eines politisch gefährlichen religiös gefärbten Irrationalismus markierte: der Austrofaschismus trat auf den Plan, und die Arbeiterbewegung wich vor ihm zurück. In Die Zukunft einer Illusion räumt Freud ein, daß der „Schatz der religiösen Vorstellungen nicht allein Wunscherfüllungen enthält, sondern auch bedeutsame historische Reminiszenzen“. Er meint damit die Begründung der Kulturvorschriften durch eine „unwiderstehliche, folgenschwere Gefühlsreaktion“ (auf den in Totem und Tabu 1912/13 beschriebenen Urvater-Mord). Die „Niederschläge der ın der Vorzeit vorgefallenen verdrängungsähnlichen Vorgänge hafteten der Kultur“ zwar noch lange an („die Religion wäre die allgemein menschliche Zwangsneurose“), aber es „wäre vorauszusehen, daß sich die Abwendung von der Religion mit der schicksalsmäßigen Unerbittlichkeit eines Wachstumsvorgangs vollziehen muß“: „Aber, nicht wahr, der Infantilismus ist dazu bestimmt, überwunden zu werden?“
Was die Gläubigen von ihrem allmächtigen Gott ungeduldig, anspruchsvoll und selbstsüchtig sofort (nach dem Tod) erwarten, nämlich Menschenliebe und Einschränkung des Leidens (Seligkeit), werde dann „unser vielleicht nicht sehr allmächtiger Gott Logos“ verwirklichen, „aber sehr allmählich, erst in unabsehbarer Zukunft und für neue Menschenkinder“.
Dieser (kritisch-rationalistische) „Gott“ stammt aus den in anarchistischen und lebensreformerischen Kreisen (und auch von Freud) hochgeschätzten Schriften des holländischen Ex-Kolonialbeamten und Sexualaufklärers E. D. Dekker (Pseudonym „Multatuli“). Das Paar „Logos“ (Vernunft) und „Ananke“ (soziale Notwendigkeit) steht hier anstelle der Schicksalsgöttin „Moira“.
Daß der Glaube an die Vernunft und den wissenschaftlichen Fortschritt keine Illusion ist, begründet Freud mit einem Argument, das an die „evolutionäre Erkenntnistheorie“ unserer Tage denken läßt: unser „seelischer Apparat“ sei „im Bemühen um die Erkundung der Außenwelt entwickelt“ worden, weshalb die „endlichen Resultate der Wissenschaft“ nicht nur „durch unsere Organisation bedingt sind, sondern auch durch das, was auf diese Organisation gewirkt hat“.
Der naturgemäße rationale Zugang zur Realität werde freilich durch religiöse Erziehung vereitelt: „Denken Sie an den betrübenden Kontrast zwischen der strahlenden Intelligenz eines gesunden Kindes und der Denkschwäche des durchschnittlichen Erwachsenen“. Wer „unter der Herrschaft von Denkverboten“ steht, könne wohl kaum das „psychologische Ideal, den Primat der Intelligenz“ erreichen.
Die kulturphilosophischen Spekulationen Freuds fanden ihre Fortsetzung in Das Unbehagen in der Kultur (1929), in dem 1933 (dem Jahr von Hitlers „Machtergreifung“ in Deutschland) publizierten Briefwechsel mit Albert Einstein Warum Krieg? und in dem 1934 bis 1938 (von der Gründung des klerikalen „Ständestaates“ bis nach dem „Anschluß“ Österreichs an Hitlerdeutschland) verfaßten Buch Der Mann Moses und die monotheistische Religion: drei Abhandlungen.
In Das Unbehagen in der Kultur macht Freud einige Einschränkungen: Mit Sicherheit wisse er „nur das eine, daß die Werturteile der Menschen unbedingt von ihren Glückswünschen geleitet werden, also ein Versuch sind, ihre Illusionen mit Argumenten zu stützen“. Und die „Schicksalsfrage der Menschenart“ scheint ihm zu sein, ob es der „Kulturentwicklung“ gelingen wird, „der Störung des Zusammenlebens durch den menschlichen Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden“. Denn „die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Naturkräfte so weit gebracht, daß sie es mit deren Hilfe leicht haben, einander bis auf den letzten Mann auszurotten“.
Trotz dieser starken Worte ist zu bedenken, daß bei Freud die „nach außen“ gerichtete Aggression bloß „sekundär“ ist (hier liegt der Unterschied zum Aggressionstrieb Alfred Adlers). 1920 hatte Sıgmund Freud in Jenseits des Lustprinzips seine letzte Triebtheorie vorgestellt. Danach befinden sich Lebens- und Todestriebe in einem Gegensatz: „Eros“ versucht „die Teile der lebenden Substanz zueinanderzudrängen und zusammenzuhalten“, der Todestrieb möchte sie wieder trennen und in den anorganischen Zustand zurückführen.
In der ersten Fassung von Das Unbehagen in der Kultur gab Freud seiner Erwartung Ausdruck, „daß die andere der beiden ‚himmlischen Mächte‘, der ewige Eros, eine Anstrengung machen wird, um sich im Kampf mit seinem ebenso unsterblichen Gegner zu behaupten“. 1931 fügte er dann den zweifelnden Schlußsatz hinzu: „Aber wer kann den Erfolg und Ausgang voraussehen?“ Da stand Adolf Hitler schon ante portas.
Wichtiger als diese berechtigte zeitbedingte Skepsis sind jedoch in Das Unbehagen in der Kultur Freuds Erörterungen des „Kulturprozesses“. Schon 1897 tauchte in einem Brief an Wilhelm Fließ der Gedanke einer „organischen Verdrängung“ auf, in den Drei Abhandlungen zur Sexunaltheorie (1905) vermutete Freud, „daß etwas in der Natur des Sexualtriebs selbst dem Zustandekommen der vollen Befriedigung nicht günstig ist“. Er führte dies auf zwei Gründe zurück: den „zweimaligen Ansatz zur Objektwahl mit Dazwischenkunft der Inzestschranke“ (das endgültige Triebobjekt ist also bloß ein „Surrogat“) und die Unterdrückung der „koprophilen Triebanteile“, die sich aus dem „aufrechten Gang“ des Menschen ergibt: Der Geruchs- tritt hinter dem Gesichtssinn zurück. Diese „organische Verdrängung“ hat „den Weg zur Kultur gebahnt“.
In Warum Krieg? skizzierte Freud den „idealen Zustand“: „Eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Triebleben der Diktatur der Vernunft unterworfen haben ... Aber das ist höchstwahrscheinlich eine utopische Hoffnung“. Jedoch sei die „Kulturentwicklung ein organischer Prozeß“, vergleichbar mit der Domestikation gewisser Tierarten. Die „mit dem Kulturprozeß einhergehenden psychischen Veränderungen ... bestehen in einer fortschreitenden Verschiebung der Triebziele und Einschränkung der Triebregungen“. Bei den Pazifisten konstatierte Freud eine bereits „konstitutionelle Intoleranz“ und „Empörung“ gegen den Krieg „aus organischen Gründen“, und fragte: „Wie lange müssen wir nun warten, bis auch die anderen Pazifisten werden?“ Es sei „vielleicht keine utopische Hoffnung“, daß Kultur und Angst vor dem Krieg das Kriegführen „in absehbarer Zeit“ beenden werden. Kulturfördernd seien „die Erstarkung des Intellekts, der das Triebleben zu beherrschen beginnt, und die Verinnerlichung der Aggressionsneigung mit all ihren vorteilhaften und gefährlichen Folgen“.
1933 kam Freud in der Neuen Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse noch einmal explizit auf das Thema von Die Zukunft einer Illusion zu sprechen: „Andererseits gehört der Intellekt — oder nenen wir ihn beı seinem uns vertrauten Namen: die Vernunft — zu den Mächten, von denen man am ehesten einen einigenden Einfluß auf die Menschen erwarten darf, die Menschen, die so schwer zusammenhalten und darum kaum zu regieren sind ... Es ist unsere beste Zukunftshoffnung, daß der Intellekt — der wissenschaftliche Geist, die Vernunft — mit der Zeit die Diktatur im menschlichen Seelenleben erringen wird. Das Wesen der Vernunft bürgt dafür, daß sie dann nicht unterlassen wird, den menschlichen Gefühlsregungen, und was von ihnen bestimmt wird, die ihnen gebührende Stellung einzuräumen. Aber der gemeinsame Zwang einer solchen Herrschaft der Vernunft wird sich als das stärkste einigende Band unter den Menschen erweisen und weitere Einigungen anbahnen. Was sich, wie das Denkverbot der Religion, einer solchen Entwicklung widersetzt, ist eine Gefahr für die Zukunft der Menschheit“.
So konnte denn der prominente Freud-Schüler Heinz Hartmann zum 80. Gecburtstag Freuds am 5. Mai 1936 in der Neuen Freien Presse schreiben: „Freuds Arbeitsgebiet war durch lange Jahre dasjenige, was man zur Zeit der Romantik die ‚Nachtansicht‘ des Daseins genannt hätte. Anerkennung und Ruhm hat man ihm lange vorenthalten. Ein Pessimist strenger Observanz ist er darum nicht geworden. In einer seiner kulturkritischen Arbeiten, in der er die bisherige Entwicklung der Menschheit und ihre Chancen für die Zukunft überdenkt, kommt er zu dem Ergebnis: die Stimme der Vernunft sei zwar leise, aber ‚sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör geschafft hat. Am Ende, nach unzählig oft wiederholten Abweisungen, findet sie es doch‘. Damit gibt uns Freud ein Stück seines Glaubensbekenntnisses — und in den Dienst jener Entwicklungsrichtung stellt er, als ein Mittel von tiefgreifender Wirksamkeit, auch die Psychoanalyse“.
Diese Passage, die wohl kaum ohne Freuds Zustimmung veröffentlicht worden ist, stellt einen Durchhalteappell dar. Seit 1933 war die Psychoanalyse in Deutschland Schritt für Schritt „judenrein“ gemacht und zusammen mit anderen therapeutischen Richtungen mit dem Nazismus „gleichgeschaltet“ worden. Den Mitgliedern der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung war von ihrer Leitung verboten worden, sich an antifaschistischen Aktionen zu beteiligen bzw. politisch engagierte Patienten zu behandeln. Die kritischsten Teile von Der Mann Moses und die monotheistische Religion wurden von Freud nicht zum Druck befördert, weil er einen für die Psychoanalyse schädlichen Zusammenstoß mit dem katholischen Austrofaschismus vermeiden wollte. Denn dieser wurde als kleineres Übel und als Schutz vor dem brutalen Hitlerfaschismus angesehen.
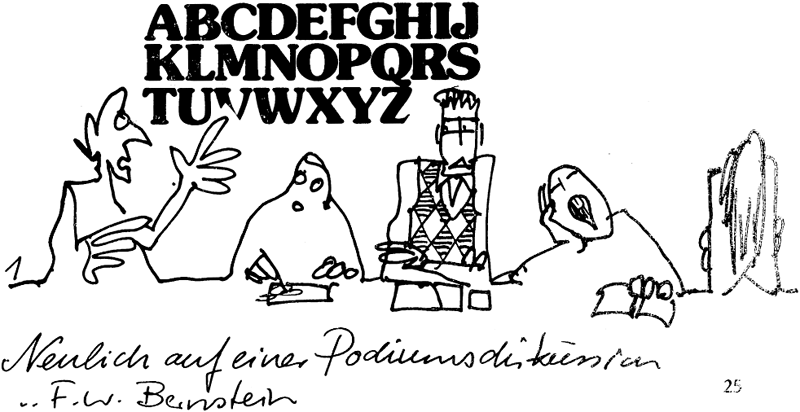
Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich verstummte jedoch in diesem Land die „leise Stimme der Vernunft“: am 13. März 1938 beschloß der Vorstand der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, „daß jeder, dem es möglich sei, aus dem Land fliehen solle und der Sıtz der Vereinigung dorthin zu verlegen sei, wo sich Freud niederlassen werde“.
In Das Unbehagen in der Kultur zählte Freud „die ersten kulturellen Taten“ auf: Gebrauch von Werkzeugen, Zähmung des Feuers, Bau von Wohnstätten. „Unter ihnen ragt die Zähmung des Feuers als eine ganz außerordentliche Leistung hervor“, denn sie ist „der Lohn für einen Triebverzicht“: Feuerlöschen durch Urinieren war ursprünglich „wie ein sexueller Akt mit einem Mann, ein Genuß der männlichen Potenz im homosexuellen Wettkampf. Wer zuerst auf diese Lust verzichtete, das Feuer verschonte, konnte es mit sich forttragen und in seinen Dienst zwingen. Dadurch, daß er das Feuer seiner eigenen sexuellen Erregung dämpfte, hatte er die Naturkraft des Feuers gezähmt“.
1931/32 spann Freud diese Theorie in einer kleinen Schrift (Zur Gewinnung des Feuers) etwas weiter aus: „Der Titane Prometheus, ein noch göttlicher Kulturheros“, hatte „die Löschung des Feuers verboten“, der halbgöttliche Herakles „sie für den Fall des Unheil drohenden Brandes freigegeben. Der zweite Mythus scheint der Reaktion einer späteren Kulturzeit auf den Anlaß der Feuergewinnung zu entsprechen“.
In Warum Krieg? lobte Freud zunächst die Römer, weil deren Eroberungen „den Mittelmeerländern die kostbare pax romana gegeben“ haben. Freilich seien die Folgen derartiger Eroberungen nicht dauerhaft, „die neu geschaffenen Einheiten zerfallen wieder, meist infolge des mangelnden Zusammenhalts der gewaltsam geeinigten Teile“. Was aus Freuds letzter Trieblehre verständlich wird: die Beimischung des Todestriebs zum Eros war einfach zu groß. Und „so ergab sich als die Folge all dieser kriegerischen Anstrengungen nur, daß die Menschheit zahlreiche, ja unaufhörliche Kleinkriege gegen seltene, aber um so mehr verheerende Großkriege eintauschte“.
Einer Klage Einsteins über den Mißbrauch der Autorität antwortete Freud: „Es ist ein Stück der angeborenen und nicht zu beseitigenden Ungleichheit der Menschen, daß sie in Führer und in Abhängige zerfallen.“ Die übergroße Mehrheit bedürfe „einer Autorität, welche für sie Entscheidungen fällt, denen sie sich meist bedingungslos“ unterwerfe. Man sollte hier „anknüpfen“, und eine „Oberschicht selbständig denkender, der Einschüchterung unzugänglicher, nach Wahrheit ringender Menschen erziehen, denen die Lenkung der unselbständigen Massen zufallen würde“. Daß dieses (aus der Lektüre Platons hergeleitete) oligarchische Konzept den italienischen Faschismus beeinflußt haben könnte, ist ziemlich unwahrscheinlich. Mussolini wird diesen Text Freuds wohl ignoriert haben.
Am 2. August 1938 verlas Anna Freud auf dem Internationalen Psychoanalytischen Kongreß in Paris im Auftrag ihres bereits im Londoner Exil lebenden Vaters eine Passage aus dessen Mann Moses, nämlich den Abschnitt Der Fortschritt in der Geistigkeit. Dieser besteht darin, daß man „gegen die direkte Sinneswahrnehmung zugunsten der sogenannten höheren intellektuellen Prozesse entscheidet, also der Erinnerungen, Überlegungen, Schlußvorgänge“. Es handelt sich dabei um das letzte Stadium des mit der „organischen Verdrängung“ ins Rollen gebrachten „Kulturprozesses“.
Historisch betrachtet beginnt diese Phase mit dem von Moses (dem aus Ägypten stammenden jüdischen Kulturheros) erlassenen Verbot, sıch eın Bild von Gott zu machen, also mit „dem Zwang, einen Gott zu verehren, den man nicht sehen kann“. Nun tritt nach dem Geruchs- auch der Gesichtssinn zurück.
Der „Fortschritt in der Geistigkeit“ hat laut Freud drei Vorläufer in der Geschichte der Menschheit: Den „im Dunkel der Urzeit“ aufgetauchten Glauben an die „Allmacht der Gedanken“, auf dem Magie und Technik beruhen (er war Ausdruck des Stolzes auf die Entwicklung der Sprache); die Ablösung des Matriarchats vom Patriarchat (die Vaterschaft kann nicht durch das Zeugnis der Sinne, sondern nur durch einen Denkvorgang erwiesen werden); dazwischen lag die Anerkennung „geistiger“ Mächte und der Seele, deren Vorbild der Windhauch war. Alle diese Fortschritte steigerten das Selbstgefühl.
Moses vermittelte darüber hinaus den Juden das Gefühl, ein auserwähltes Volk zu sein, und „durch die Entmaterialisierung Gottes kam ein neues, wertvolles Stück zu dem geheimen Schatz des Volkes hinzu ... ihr Schrifttum“. In Anspielung auf die Vernichtung der Psychoanalyse ın Wien und auf seine Emigration nach London schrieb Freud: „Unmittelbar nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch Titus erbat sich Rabbi Jochanan ben Sakkai die Erlaubnis, die erste Thoraschule in Jabne zu eröffnen. Fortan war es die Heilige Schrift und die geistige Bemühung um sie, die das versprengte Volk zusammenhielt.“
Begonnen hatte diese Entwicklung jedoch mit der Großtat des Kulturheros Moses: „Der Vorrang, der durch etwa 2000 Jahre im Leben des jüdischen Volkes geistigen Bestrebungen eingeräumt war, hat natürlich seine Wirkung getan; er half, die Rohheit und die Neigung zur Gewalttat einzudämmen, die sich einzustellen pflegen, wo die Entwicklung der Muskelkraft Volksideal ist. Die Harmonie in der Ausbildung geistiger und körperlicher Tätigkeit, wie das griechische Volk sie erreichte, blieb den Juden versagt. Im Zwiespalt trafen sie wenigstens die Entscheidung zugunsten des kulturell Bedeutsameren.“
Dieses Statement erfolgte fünf Jahre nach den ersten Bücherverbrennungen: Im Mai 1933 waren die „Schriften der Schule Sigmund Freuds“ im Berliner Lustgarten „den Flammen übergeben“ worden (in München kam „bloß“ das Werk Alfred Adlers auf den Scheiterhaufen), 1936 beschlagnahmten die Nazis die Bestände des Psychoanalytischen Verlags in Leipzig, und 1938 dessen Lager in Wien.
Die Herausstellung des jüdischen Beitrags zum „Fortschritt in der Geistigkeit“ sieht wie eine Replik auf die skandalösen Äußerungen C. G. Jungs zum Unterschied von germanischer und jüdischer Psychologie aus. Der frühere Freund, Schüler, Mitarbeiter und „Kronprinz“ Sigmund Freuds (er hatte sich von seinem Lehrer 1913/14 getrennt) schrieb 1933 in einem „Geleitwort“ des gleichgeschalteten Zentralblattes für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete: „Die tatsächlich bestehenden und einsichtigen Leuten schon längst bekannten Verschiedenheiten der germanischen und der jüdischen Psychologie sollen nicht mehr verwischt werden, was der Wissenschaft nur förderlich sein kann“. Einige Zeilen später schränkte er freilich ein: „Dabei soll, wie ich ausdrücklich feststellen möchte, keine Minderbewertung der semitischen Psychologie gemeint sein, so wenig als es eine Minderbewertung des Chinesen bedeutet, wenn von der eigenartigen Psychologie des fernöstlichen Menschen die Rede ist.“ Dieser Beschwichtigungsversuch ist zweideutig. Zwar bewunderte C. G. Jung die chinesische Kultur sehr, doch war seine Äußerung in einem 1936 in den USA abgehaltenen Seminar über Kinderträume bekannt: „... sind oft so perverse Geschichten möglich, wie die, daß ein junges Mädchen mit einem Neger oder Chinesen durchbrennt, und andere Dinge, die bei uns einigen bevorzugten Kriminellen vorbehalten bleiben.“
Die Antwort auf Jungs Attacke ließ nicht lange auf sich warten. Am 27.2.1934 meldete sich der in Berlin ausgebildete Züricher Psychoanalytiker Gustav Bally in der Neuen Zürcher Zeitung zu Wort. Unter der Schlagzeile „Deutschstämmige Psychotherapie“ schrieb er: „Will Jung, daß wir bei einer wissenschaftlichen Arbeit fragen: ist sie germanisch oder jüdisch? Wie überhaupt will er germanische und jüdische Psychologie unterscheiden?“ C. G. Jung empfand dies als „Hetze“ und wehrte sich (am 13. und 14. März in der NZZ unter dem Titel „Zeitgenössisches“): „Erster Grundsatz der Psychotherapie“ sei es, „am ausführlichsten von jenen Dingen zu sprechen, die am kitzligsten, gefährlichsten und mißverständlichsten“ sind, und deshalb habe er „die Judenfrage auf den Tisch des Hauses“ gelegt. Er sei kein solcher „Gleichmacher“ wie Freud und Adler, sondern beharre auf der Existenz „ethnischer Differenzen“ und auf der „Eigenart“.
In einem „Nachtrag“ (abgedruckt am 15. März in der NZZ) machte Jung dann noch geltend, daß er sich schon lange vor Hitlers Machtergreifung, nämlich 1918, zur „Rassenpsychologie“ bekannt hatte. Er meinte damit seine Schrift Über das Unbewußte, in der er sich von Freud und Adler abgrenzte.
So warf er Freud vor, bei der „naturwissenschaftlichen Färbung“ des Begriffes „unbewußt“ „stehengeblieben“ zu sein, nur ein persönliches (aus verdrängten Trieben und Wünschen bestehendes) Unbewußtes zu kennen, und die psychische Dynamik auf eine einzige „Kraft“ zurückzuführen: die Sexualität. Dagegen habe er, Jung, in „mythologischen Phantasien“ und in den „schöpferischen Phantasien“ von Künstlern und Denkern auch ein „überpersönliches Unbewußtes“ entdeckt, das aus der „vererbten Struktur des Gehirns“ bestehe (bei Schopenhauer ist dies — mit Bezug auf Kant — der „Intellekt“! J. D.). Es handle sich dabei um einen „‚allgegenwärtigen‘ und ‚allwissenden‘ Geist“, der (diese Formulierung ist wichtig!) „den Menschen weiß“, und zwar nicht als konkretes Individuum, sondern als „Mythus“. Die „Hirnstruktur“ erzähle ihre eigene Geschichte, „welche die Geschichte der Menschheit ist“ (nicht zu verwechseln mit der objektiven, „gemachten“ Geschichte): „Den unendlichen Mythus von Tod und Wiedergeburt.“

Ein Jahr später (in seinem Londoner Vortrag Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens) sprach Jung schon von „Geistern“ als Inhalten des kollektiven Unbewußten, die für „tiefgreifende historische Veränderungen“ verantwortlich seien, und sich dabei des „Individuums oder mehrerer von besonders kräftiger Intuition“ bedienten, „welche diese Veränderungen im kollektiven Unbewußten wahrnehmen und sie in unmittelbare Ideen übersetzen“. Das davon ergriffene Volk befinde sich dann in einem der Psychose vergleichbaren Geisteszustand. Wenn aber die „Übersetzung“ in eine „mitteilbare Sprache“ gelinge, so entstehe eine „erlösende Wirkung“.
Auch Freud hatte „Urphantasien“ entdeckt, die in „das Leben der Vorzeit hinausgreifen“, (lamarckistische) „Erinnerungsspuren an das Erleben früherer Generationen“. Sie ergänzen jedoch nur das eigene Erleben des Individuums, wo dieses „allzu rudimentär geworden ist“. So schreibt er 1917 in den Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse: „Es scheint mir sehr wohl möglich, daß alles, was uns heute in der Analyse als Phantasie erzählt wird, die Kinderverführung, die Entzündung der Sexualerregung an der Beobachtung des elterlichen Verkehrs, die Kastrationsdrohung — oder vielmehr die Kastration —, in den Urzeiten der menschlichen Familie einmal Realität war und daß das phantasierende Kind einfach die Lücken der individuellen Wahrheit mit prähistorischer Wahrheit ausgefüllt hat“. Im Kapitel „Nachträge aus der Urzeit Lösung“ von Aus der Geschichte einer infantilen Neurose (der Fall des „Wolfsmannes“!) setzt sich Freud mit den Ansichten Jungs auseinander, und entlarvt die Wiedergeburtsphantasie seines Patienten als „verstümmelte, zensurierte Wiedergabe der homosexuellen Wunschphantasie“.
Dieses „Reduzieren“ des Psychischen auf „primitive Sexualwünsche“ (bei Freud) und „primitive Machtabsichten“ (bei Adler) lastete Jung der kollektiven Psychologie „des Juden“ an. Der sei nicht mehr primitiv genug, sondern ın „höherem Maße domestiziert“ als der germanische Christ, weshalb er Primitivität als wohltuende Entlastung von seiner Hochzivilisiertheit nötig habe. Für Germanen (zu denen sich der blonde Jung selbst zählte — den Nazis kam er freilich „ostisch“ vor) sei dies jedoch höchst gefährlich: „Wir Germanen haben noch einen echten Barbaren in uns, der nicht mit sich spaßen läßt.“ Das Christentum habe den germanischen Barbaren „in seine untere und obere Hälfte zerteilt“, die dunkle verdrängt und die helle domestiziert. „Die untere Hälfte aber harrt der Erlösung und einer zweiten Domestikation. Bis dahin bleibt sie assoziiert mit den Resten der Vorzeit, mit dem kollektiven Unbewußten, was eine eigentümliche und steigende Belebung des kollektiven Unbewußten bedeuten muß.“
Den Beginn dieser Entwicklung sah Jung schon in der französischen Aufklärung und der französischen Revolution, und „von da an kam der unbewußte Heide in uns nicht mehr zur Ruhe“. Weiter ging’s dann über Goethe, Hölderlin, Nietzsche und die Psychoanalyse. Und „je mehr die unbedingte Autorität der christlichen Weltanschauung sich verliert, desto vernehmlicher wird sich die ‚blonde Bestie‘ in ihrem unterirdischen Gefängnis umdrehen und uns mit einem Ausbruch mit verheerenden Folgen bedrohen“. Es ist da nach Jung „ein noch unberührtes Vermögen, eine Jugendlichkeit, ein Schatz an Unverbrauchtem, ein Versprechen der Wiedergeburt“. „Der Jude“ aber „ist in arger Verlegenheit um jenes Etwas ..., das von unten neue Kraft empfängt, um jenes Erdhafte, das der germanische Mensch in gefährlicher Konzentration in sich birgt“. So C. G. Jung 1918.
Fünfzehn Jahre später gab er der „blonden Bestie“ Zucker und verlangte Gehorsam für die laute Stimme der Unvernunft. In einem Berliner Rundfunkinterview appellierte er an die Erwachsenen, vor der Jugend zurückzutreten und sich mit „diesem naturnotwendigen Geschehen“ abzufinden. Denn der „Führer“ sei die „Inkarnation der Volksseele und ihr Sprachrohr“, die Nazis stellten einen neuen Adel dar, und Adel glaube „naturnotwendig an das Blut und an die Rassenausschließlichkeit“. „Demokratie hin oder her“, in Zeiten des Führertums sei die „ziellose Konversation parlamentarischer Beratung“ nicht gefragt. Im Jahr darauf (in seinen bisher unveröffentlicht gebliebenen englischen Seminarvorträgen über Nietzsches Zarathustra) sprach Jung unentschlossen vom „reinen, göttlichen oder dämonischen Wahnsinn“ der Nazis, für den Nietzsche in Also sprach Zarathustra der Prophet gewesen sei.
Zur selben Zeit versuchte er, das Phänomen Hitler mit Hilfe seiner Archetypenlehre zu erklären. Der Aufsatz hieß schlicht und einfach Wotan, und erschien 1936 in der Neuen Schweizer Rundschau. Mehr als kurios, nämlich „geradezu pikant“, kann man da lesen, sei die Tatsache, daß „in einem eigentlichen Kulturland, das schon geraume Zeit jenseits des Mittelalters gewähnt wurde, ein alter Sturm- und Rauschgott, nämlich der längst im historischen Ruhestand befindliche Wotan wieder, wie ein erstorbener Vulkan, zu neuer Tätigkeit erwachen“ konnte.
Angefangen habe es ja schon mit dem deutschen Wandervogel. Dann sei das ziellose Wandern der Arbeitslosen gekommen, und jetzt marschiere ganz Deutschland in der Hitler-Bewegung.
Nietzsche, und in seinem Gefolge die München-Schwabinger „Kosmiker“ Alfred Schuler, Stefan George und Ludwig Klages hätten „jenes Rauschen im Urwald des Unbewußten“ vorausgeahnt, es jedoch fälschlich auf Dionysos, „puer aeternus“ und „kosmogonischen Eros“ zurückgeführt, und nicht auf den Wanderer, Jäger und Zauberer Wotan. Dieser sei „eine Grundeigenschaft der deutschen Seele, ein seelischer ‚Faktor‘ irrationaler Natur, eine Zyklone, welche den kulturellen Hochdruck abbaut und wegreißt“, ein „Archetypus, der als autonomer seelischer Faktor kollektive Wirkungen erzeugt und dadurch ein Bild seiner eigenen Natur entwirft“. Er „verkörpert die triebmäßig-emotionale sowohl wie die intuitiv-inspirierende Seite des Unbewußten“. Hitler seı von ihm „ergriffen“ und „ergreife“ seinerseits „das ganze Volk dermaßen, daß sich alles in Bewegung setzt, ins Rollen gerät und unvermeidlicherweise auch in gefährliches Rutschen“.
Auch zum Antisemitismus fiel C. G. Jung etwas ein: Der „rastlose Wanderer Wotan“ sei vom Christentum in den Teufel verwandelt worden, und die Wanderer-Rolle habe Ahasver übernommen, der „ewige Jude“. Sie sei also „auf den Juden projiziert“ worden, „wie man ja in der Regel unbewußt gewordene Inhalte im anderen wiederfindet“. Jung: „Auf alle Fälle ist die Koinzidenz von Antisemitismus und Wotanserwachen eine psychologische Finesse, die vielleicht erwähnt werden darf ...“
Wie man es von eınem berühmten Psychotherapeuten erwarten darf, stellte Jung auch die Diagnose und schlug eine Heilmethode vor. Im Oktober 1938 erklärte er dem US-Journalisten H. R. Knickerbokker, der ihn für Hearst’s International Cosmopolitan in New York interviewte, Adolf Hitler sei ein „echter mystischer Meedizinmann“, wıe man ihn „seit der Zeit Mohammeds nicht mehr gesehen“ habe. Der „Führer“ handle „unter Zwang“. Wäre Hitler sein Patient, würde er es als Arzt nicht wagen, „ihm zu sagen, er solle seiner inneren Stimme nicht gehorchen“, vielmehr würde er versuchen, „dem Patienten die Stimme zu interpretieren, um so anzuregen, daß er sich so aufführt, daß es für ihn und die Gesellschaft weniger schmerzhaft ist, als wenn er der Stimme unmittelbar, ohne Interpretation, Folge leisten würde“. In diesem Sinn gab Jung den Westmächten den Rat, Hitler nicht aufzuhalten, sondern abzulenken: „Laßt die Deutschen nach Rußland ziehen.“ Um „diese Mahlzeit zu beenden“, könnten sie „hundert Jahre brauchen“. Die USA aber sollten Gewehr bei Fuß stehen, „um den Krieg zu entscheiden, wenn er kommt“. Sie seien „die letzte Zuflucht der westlichen Demokratie“.

Erst nach dem Scheitern Hitlers wußte Jung dessen „genauere Diagnose: Pseudologia phantastica, jene Hysterieform, welche sich durch die besondere Fähigkeit auszeichnet, die eigenen Lügen selber zu glauben“. Nun ließ er kein gutes Haar am „Führer“: „Traurige Unbildung, darauf gegründete übersteigerte Einbildung bis zum Wahn, nur mittelmäßige Intelligenz bei hysterischer Verschlagenheit und adoleszente Machtphantasie standen diesem Demagogen auf dem Gesichte geschrieben.“ Hitler war (so Jung 1946 in Der Kampf mit dem Schatten) „die erstaunlichste Verkörperung aller menschlichen Minderwertigkeiten ... Er stellte den Schatten, den inferioren Teil von jedermanns Persönlichkeit dar, in überwältigendem Maße, und dies war ein weiterer Grund, weshalb man ihm verfiel“. 1945 (in Nach der Katastrophe) hatte Jung den Deutschen deshalb eine Kollektivschuld aufgerechnet, eine „psychologische“ bloß, wie er betonte, keine „juristisch-moralische“. Jung: „Die psychologische Kollektivschuld ist ein tragisches Verhängnis; sie trifft alle, Gerechte und Ungerechte, alle, die irgendwie in der Nähe jenes Ortes waren, wo das Furchtbare geschah.“ Ihm selbst (schrieb Jung 1946 im Nachwort zu „Aufsätze zur Zeitgeschichte“) sei es zwar „mit der Machtübernahme Hitlers klar“ gewesen, daß „sich in Deutschland eine Massenpsychose vorbereitete“, aber „der schließliche Ausgang ... war mir noch fraglich, wie mir die Gestalt des Führers zunächst bloß als ambivalent vorkam“. Auch für diese Ambivalenz sind in C. G. Jungs germanischer Psychologie letztlich die Archetypen verantwortlich: sie sind ja „bipolar, das heißt, sie haben eine positive und eine negative Seite“. Und mag kommen, was will: C. G. Jung kann so immer recht behalten.
Dem „Kulturprozeß“ bei Sigmund Freud entspricht in der Analytischen Psychologie C. G. Jungs der „Individuationsprozeß der Menschheit“. „Individuation“ bedeutet „Selbstwerdung“ (Integration der gesamten Psyche um den zentralen Archetypus „Selbst“ herum), und nicht bloß „Bewußtwerdung“ (des Ich). Ein wichtiger Individuationsschritt ist die Auseinandersetzung mit dem „Schatten“. In seinen späteren Lebensjahren hat C. G. Jung zugegeben, daß er die Abgründigkeit des Bösen im Nazismus ebenso unterschätzt hat wie die ausschlaggebende Rolle des Bewußtseins im „Individuationsprozeß“. Jungs Biographin Aniela Jaffe schreibt darüber (in Aus Leben und Werkstatt von C. G. Jung, Zürich 1968): „Das Bewußtsein entscheidet. Man könnte Jungs Revidierung der wissenschaftlichen Auffassung, die von ihm vollzogene Verlagerung der Werte vom typologischen Gesichtspunkt aus als Wandlung des ‚Romantikers‘ zum ‚Klassiker‘ bezeichnen und könnte spekulieren, daß der Klassiker Jung dem Nationalsozialismus nicht einmal mehr eine Chance gegeben hätte.“
Aus seiner Autobiographie Erinnerungen, Träume, Gedanken geht hervor, daß der von Jung im Nazismus entdeckte „Archetypus Wotan“ eigentlich Richard Wagners Ring des Nibelungen entnommen ist. „Deshalb“ konnte er nur in die Katastrophe führen. Wer den Ring hat, besitzt ihn zu Unheil und Verderben. Aus Wotans Machtgier, aus seinem Vertragsbruch und seinem Todestrieb folgt die Götterdämmerung. Das Siegfried zugedachte anarchisch-revolutionäre Erlösungswerk endet mit Siegfrieds Tod.
C. G. Jung hat sich selbst mit Siegfried identifiziert. „Blonder Siegfried“ war einer seiner Spitznamen. In seinen Erinnerungen berichtet er von einem Traum, den er 1913 hatte (in diesem Jahr trennte er sich von Freud). In ihm ermordete er Siegfried. Sein Komplize dabei war ein „unbekannter braunhäutiger Jüngling, eın Wilder“. Nach der Tat blieb ein „unerträgliches Schuldgefühl“ zurück. Jung deutet den Traum kollektiv: Siegfried stelle „das dar, was die Deutschen verwirklichen wollten, nämlich den eigenen Willen heldenhaft durchzusetzen“. Das habe nun nicht mehr auf ihn „gepaßt“, deshalb mußte er Siegfried umbringen — „denn es gibt Höheres, dem man sich unterwerfen muß als der Ich-Wille“.
Ich schlage eine andere Interpretation vor: Siegfried ist der Sohn Siegmunds (Sigmund Freuds), und als solchen brachte sich Jung selbst um. Der Wilde ist Jungs „Schatten“ (K. R. Eissler sieht in ihm Hagen, der in Jung aktiv wurde). Andererseits sind Siegmund und Siegfried (nicht bei Wagner, sondern in ihren mythologischen Ursprüngen) ein und dieselbe Person. So gesehen ermordete Jung im Traum Sigmund Freud. Jung hat einmal den Plan verfolgt, mit Sabina Spielrein, seiner jüdischen Patientin und Geliebten, ein Kind namens Siegfried zu zeugen. Es sollte (da Siegmund bei Wagner der Vater Siegfrieds ist) Freud und Jung, jüdische und germanische Psychoanalyse in sich vereinen. Doch bekehrte sich Sabina Spielrein schließlich als Psychoanalytikerin zu Freud. Jung hatte sich seiner Freundin gegenüber nicht sehr edel verhalten und verspürte deshalb Schuldgefühle ... Wie aus seiner Autobiographie und dem Briefwechsel mit Freud weiter hervorgeht, laborierte Jung an einem ungelösten, durch ein homosexuelles Trauma verschärftes Vaterproblem (das die Beziehung zu Freud belastete und schließlich beendete). Nach der Lektüre von Goethes Faust fühlte er sich für den Mord an den beiden alten Leuten (Elternfiguren) Philemon und Baucis persönlich verantwortlich. Und im Paar Faust-Mephisto sah er seine eigenen inneren Gegensätze dramatisiert (Jung: „Ich konnte ja damals nicht ahnen, wie sehr Goethes seltsamer Heldenmythus kollektiv war und deutsches Schicksal prophetisch vorausnahm“). Für sich persönlich versuchte er, das deutsche „Faust“-Problem dadurch zu lösen, daß er in seinem Werk bewußt an das „anknüpfte“, was „Faust übergangen hatte: die Respektierung der ewigen Menschenrechte, die Anerkennung der Alten und die Kontinuität der Kultur und der Geistesgeschichte“.
Auch verteidigte er zunehmend die „Väter“ gegen psychoanalytische Angriffe. 1909 hatte Jung in seinem (von Otto Groß inspirierten) Aufsatz Die Bedeutung des Vaters für das Schicksal des Einzelnen noch betont, die autoritäre Erziehung durch den Vater verursache Neurosen und Psychosen, denn sie verhindere die Entfaltung der kindlichen Eigenart. Im Vorwort zur zweiten Auflage (1926) brachte er dazu noch die Mutter aufs Tapet, beide fungieren jedoch als bloße Vermittler von „Naturgesetzen und Naturgewalten, zwischen denen der Mensch auf der Schneide eines Messers geht“. 1948 veränderte Jung den Text des Aufsatzes selbst. Nun entstammte die „schicksalsdeterminierende Kraft des Vaterkomplexes dem Archetypus, dessen Möglichkeiten, im Guten wie ım Bösen, die menschliche Reichweite um ein Vielfaches übersteigen“. Darum täte man, schreibt Jung, dem individuellen Vater „schwerstes Unrecht, wenn man ihn für die schicksalschaffende Macht dieses Systems, eben des Archetypus, verantwortlich machen wollte“. Nach dem Bruch mit Freud hatte sich Jung einen Vaterersatz halluziniert, den er zu seinem Seelenführer machte. Er fertigte von ihm sogar (im Roten Buch) Zeichnungen im Jugendstil an. Die Figur hieß — „Philemon“.
Im Roten Buch kann man auch ein Bildnis des „Schattens“ bewundern (Bildtext dazu: „Dieß ist das stiffliche Gold, in welchem der Schatten Gottes wohnt“). Die dunkle Figur erinnert an jene Pastorengestalten (Jungs Vater war Pastor) im Talar bzw. Gehrock und mit hohen Hüten, vor denen dem Kind C. G. Jung gegraut hatte. Auf Seite 54 wächst aus dem Maul einer phallischen Schlange eine fünffach verzweigte Pflanze (Feuerzunge?). Das Bild soll „Brahmanaspati“ darstellen, den „Herrn“ der fundamentalen Macht „Brahman“ und Repräsentanten von „Rita“, der universellen Norm. Auf Seite 64 wirft sich eine kleine Figur (der indische Weltenschöpfer Prajapati) vor einer schwertähnlichen phallischen ejakulierenden Feuersäule anbetend zu Boden. Prajapati soll sich (nach der Legende) durch ein Opfer (Selbstopfer) vor dem von ihm erschaffenen Feuer (Agni) gerettet haben. Diese Bilder aus dem Roten Buch erinnern an einen Traum, den C. G. Jung als Kind gehabt hatte: In einem unterirdischen Gewölbe stand ein goldener Thronsessel, von dem ein riesiger lebender Phallus aufragte. Ganz oben auf dessen Glans befand sich ein Auge, das unbewegt nach oben blickte. Über dem Kopf des Phallus „herrschte eine gewisse Helligkeit“. Dazu ertönte (im Traum) die Stimme von C. G. Jungs Mutter: „Ja, schau ihn dir nur an. Das ist der Menschenfresser!“ Jung sah in dem Ding „auf alle Fälle einen unterirdischen und nicht zu erwähnenden Gott ... eine von mir nicht gesuchte, schreckliche Offenbarung“.
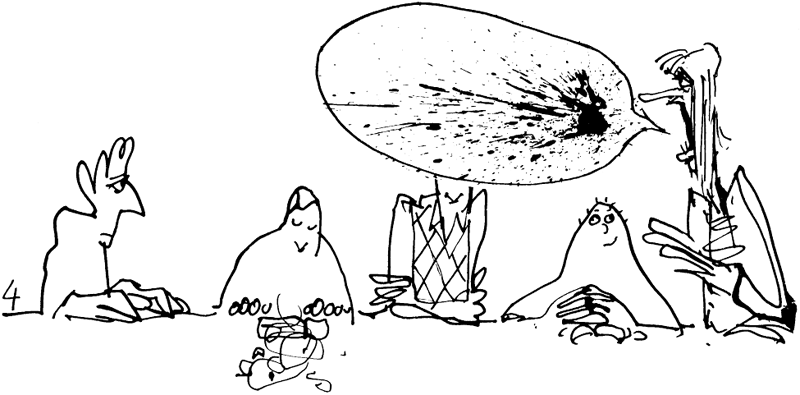
1923, zwei Monate nach dem Tod seiner Mutter, begann C. G. Jung mit dem Bau eines steinernen Mandalas (Symbols seiner Persönlichkeit) in Bollingen am Ufer des Zürichsees. Zunächst war es ein Wohnturm, den er im Lauf der Zeit durch An- und Zubauten immer mehr erweiterte. Hier verkehrte Jung mit den Archetypen bzw. den „Toten“. Über dem Eingang des Turms brachte er die Inschrift an: „Philemonis Sacrum — Fausti Poenitentia“ (Philemons Heiligtum — Faustens Sühne). Auf diese Weise versöhnte sich Jung mit dem Vater. 1956, ein Jahr nach dem Tod seiner Frau (Jung war 81), fühlte er „die innere Verpflichtung, zu dem zu werden, der ich selber bin“. So erhöhte er denn (fünf Jahre vor seinem Tod) den Mittelteil des Turms um ein Stockwerk — zum Zeichen für nun endlich erlangte „Überlegenheit des Bewußtseins“.


