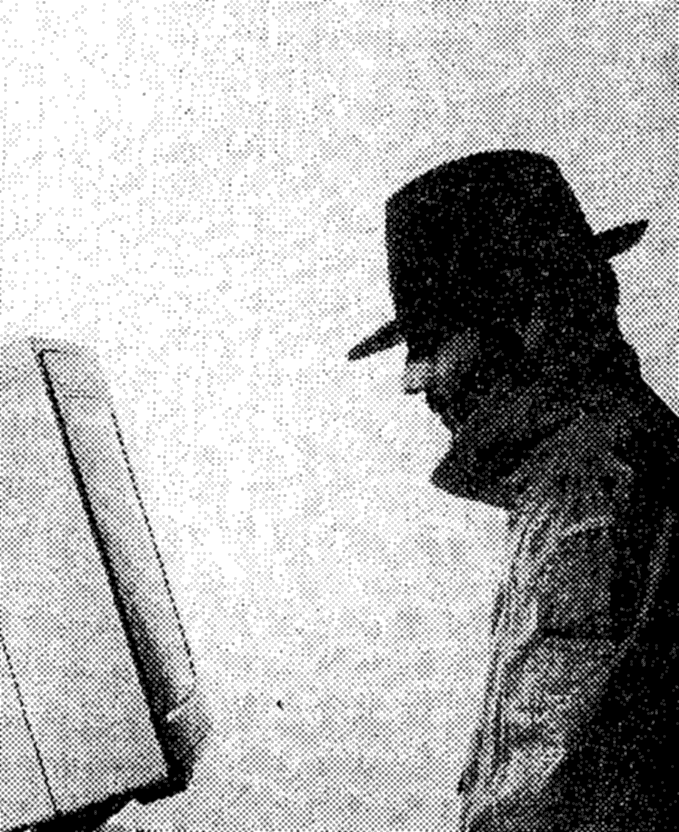Der Polizeistaat kommt — wer kann ihn noch stoppen?
Die Polizei ist ein gewaltiger Apparat, der nach eigenen Methoden arbeitet und eigene Zwecke verfolgt. In Österreich ist seine Tätigkeit kaum geregelt und einer breiteren Öffentlichkeit kaum bekannt. Die Justiz ist vielfach zum Vollzugsorgan der Polizei verkommen. Eine saftige Weide für schwarze Schafe.
In jüngster Zeit beschäftigen Polizeiübergriffe bei Demonstrationen, brutale Verhörmethoden, ungerechtfertigte Polizeihaft und sogar die verborgenen Aktivitäten der Staatspolizei die Öffentlichkeit. Anlaßfälle dafür gibt es genug und eine Eskalation der Polizeigewalt in den vergangenen Jahren ist unverkennbar. Gewalt und Willkür der österreichischen Sicherheitsbehörden gehören aber schon seit jeher zum Alltag, sie haben Tradition und System.
„Schwarze Schafe“ und „normale Staatsgewalt“
Ein vor kurzem erschienener Bericht des grünen Parlamentsklubs enthält 139 „Fallbeispiele“ für verschiedenste Übergriffe von Polizei und Gendarmerie gegen die persönliche Integrität — geschehen zwischen dem 4. Februar 1980 und dem 30. September 1988. Die überwiegende Mehrzahl der Opfer erlitt leichte und schwere Körperverletzungen, vier Menschen wurden von Sicherheitsorganen erschossen, ungerechtfertigte Festnahmen und überlange Anhaltungen gehören nach dieser Untersuchung ebenfalls zum Polizeialltag. Die Bundeshauptstadt Wien liegt mit 87 bekannt gewordenen Fällen weit über dem Durchschnitt.
Es ist allerdings anzunehmen, daß die dargestellten Fälle nur die Spitze des Eisberges bilden und die Dunkelziffer wahrscheinlich ein Vielfaches beträgt. Die Rede ist hier von „Eskalationen“ der Polizeigewalt, von „Einzeltätern“, „Übereifrigen“ und „Schwarzen Schafen“, denen in der „Hitze des Gefechts“ die Hand ausrutscht (oder der Finger am Abzug). Von jenen Vorfällen also, die — falls sie öffentlich bekannt werden — von den Verantwortlichen als bedauerlich aber untypisch für die Exekutive hingestellt werden. Die meisten Anzeigen gegen Polizisten werden vom Staatsanwalt nach § 90 StPO zurückgelegt. Aber selbst wenn es zu einem Strafverfahren kommt, dürfen prügelnde Polizisten noch mit Freispruch rechnen, „weil sich hier Richter — aus welchen Gründen auch immer — nicht einmal anders entscheiden trauen oder die Wahrheitsfindung nicht so ernst nehmen.“ (Zitat Volksanwalt Jossek). Die Opfer bekommen dann zum Schaden auch noch den Spott der Justiz in Form von Verleumdungsurteilen. Viele Betroffene verzichten daher von vorneherein auf eine Anzeige.
Schon die Zahl der Fälle zeigt, daß Gewalttätigkeit durchaus nicht „untypisch“ für die Polizei ist. Das Verständnis, das Staatsanwälte und Richter für „harte Methoden“ zeigen, erweist, daß „zur Staatsgewalt eben auch Staatsgewalttätigkeit (gehört)“ (Abg. PeterPilz in der Studie des grünen Klubs).
Der Apparat: eigene Ziele und eigene Methoden
Die Polizei bildet seit jeher einen besonderen Teil staatlicher Verwaltungstätigkeit. Dem absolutistischen Landesherm diente das „ius politiae“ nicht nur zur Festigung und Sicherung seiner Macht, sondern auch zur bevormundenden Fürsorge für seine Untertanen. Der liberale Rechtsstaat drängte zwar den Polizeibegriff auf die Gefahrenabwehr und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit zurück.
Worauf aber auch der bürgerliche Rechtsstaat bis zum heutigen Tage weder verzichten will noch kann, sind die umfassenden Überwachungs- und Zugriffsmöglichkeiten, auf die sich letztlich jede staatliche Autorität stützt. Was die Polizei angeht, ist in Österreich der Rechtsstaat allerdings im Projektstadium steckengeblieben. Artikel II § 4 Abs 2 Übergangsgesetz 1929: „Bis zur Erlassung bundesgesetzlicher Bestimmungen über die Befugnisse auf dem Gebiet der allgemeinen Sicherheitspolizei können die mit der Führung solcher Angelegenheiten betrauten Behörden zum Schutz der gefährdeten körperlichen Sicherheit von Menschen oder des Eigentums innerhalb ihres Wirkungsbereiches die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Anordnungen treffen und deren Nichtbefolgung als Verwaltungsübertretung erklären.“ Bis heute stützen sich alle typischen Polizeimaßnahmen (wie Anhaltung, erkennungsdienstliche Behandlung, Überwachung, Eindringen in Wohnungen, Räumung von Gebäuden ...) auf diese Generalklausel. Fünfzig Jahre nach deren Inkrafttreten schrieb Bernd-Christian Funk: „Zum Unterschied von der inhaltlichen Limitation des Polizeibegriffs ist in Österreich die Einholung der polizeilichen Verwaltungstätigkeiten in die Funktionsbedingungen des Rechtsstaates nur unvollständig verwirklicht worden. ... Das Recht der Sicherheitspolizei ist nur bruchstückhaft geregelt und wird durch eine geradezu vorrechtsstaatlich anmutende, als Provisorium konzipierte, ... Generalklausel dominiert.“ Versuche zur Schaffung eines Polizeibefugnisgesetzes nach bundesdeutschem Vorbild scheiterten bisher am Widerstand aus den Reihen der Polizeibeamten (wenn die Gewerkschaft nicht will, bleiben alle Diskussionen akademisch). Funk folgert richtig: Vermutlich ist hier eines der letzten Reservate für eingreifende Verwaltungstätigkeit zu sehen, die sich unter dem Titel angeblicher Funktionserfordernisse einer näheren gesetzlichen Regelung zu entziehen versteht.
Und was Funktionserfordernisse der Polizei sind, bestimmt eben die Polizei selbst. Rund 6.500 Polizisten gibt es in Wien (sagt deren Präsident Günther Bögl), darunter ein Heer von Kriminalisten, Technikern und sonstigen Spezialisten. Über hundert Juristen sind in 23 Bezirkskommissariaten tätig. Sie alle werden unterstützt durch einen immensen Aufwand an Technik. In der Wiener Rossauerkaserne sitzt das (elektronische) Gehirn der Polizei: das „Elektronische kriminalpolizeiliche Informationssystem“, kurz „EKIS“. Via Fernübertragung haben damit sämtliche Wiener Funkstreifen, Gendarmerieposten, Bundesheer, Strafgerichte, Grenzkontrollstellen und sogar Gebietskörperschaften Zugang zu Daten aus den Bereichen: Strafregister, Personenfahndung, Personeninformation, Sachenfahndung, KFZ-Fahndung, KFZ-Zulassung, Meldedaten. Auch wenn der zuständige Beamte des Innenministeriums nicht einmal den Begriff der Rasterfahndung kennen will — technisch machbar ist sie. Selbst wenn sich Regierung und Parlament doch noch zur Schaffung eines Polizeibefugnisgesetzes durchringen — wer soll seine Einhaltung überwachen?
Polizei und Justiz
120.000 Aktenvorgänge legte die Bundespolizeidirektion Wien allein in einem Jahr der Staatsanwaltschaft vor. In der Theorie ist die Polizei nur ein Hilfsorgan der Anklagebehörde, unter deren Aufsicht und für deren Zwecke sie Material zusammenträgt und aufbereitet. In der Praxis hat sich die Polizei aber weitgehend verselbständigt: Sie verdächtigt Personen, nimmt sie fest, führt Verhöre und Ermittlungen durch und legt Richtern und Staatsanwälten die weitere Vorgangsweise nahe. Wenn solche „Vorgänge“ überhaupt in den Bereich der Justiz gelangen. Der Grazer Rechtssoziologe Wolfgang Stangl untersuchte Anfang der achziger Jahre das Schicksal von Tatverdächtigen in Österreich: In Wien wurden von hundert Verdächtigen 20 tatsächlich festgenommen. Zum Pflichtverhör durch den Untersuchungsrichter gelangten schon nur mehr 17 Prozent. Angeklagt wurden 12 bis 13 Prozent und nur mehr vier von hundert polizeilich Verfolgten wurden dann tatsächlich verurteilt. Die ganze Prozedur dauert im Durchschnitt 86 Tage. Hervorzuheben ist an dieser Untersuchung, daß in den westlichen Bundesländern wesentlich weniger festgenommen wird — beispielsweise liegt die Haftrate in Innsbruck bei nur 8 Prozent. Stangl glaubt auch, die Ursache für dieses Mißverhältnis zu kennen: „Ich meine, daß die Rechtskultur in diesem Land einfach kaputt ist. Die Richter sind keine unabhängigen Wahrer des Gesetzes, sondern vielfach zu Erfüllungsgehilfen der Polizei verkommen. Vor allem dort, wo sich die Polizei besonders deutlich als eigenständiger Apparat neben der Justiz etabliert hat.“ Der Wiener Anwalt Thomas Prader ergänzt: „Die meisten Richter agieren nur noch aufgrund der Polizeiberichte. Was beispielsweise der Anwalt des Beschuldigten in der Verhandlung vorbringt ist ihnen ziemlich egal.“ Es trifft also zu, was Otto Kirchheimer schon 1965 über Polizei und Justiz bemerkte: „Die Tendenz der Polizei, die Anklagebehörde aus der Voruntersuchung hinauszudrängen und ihre Zuständigkeit auf die Vorbereitung der Anklageschrift zu reduzieren.“ Und „ist (der Richter) zum Routinier geworden, will er sich geistig nicht überanstrengen und hat er genug Erfahrung darin, wie Fälle zu verlaufen pflegen, so verzichtet er bald auf das vielleicht allzu mühselige Geschäft des Durchdenkens der ersten instinktiven Eingebung.“
aus: Juridikum 0/89, Seite 13f.